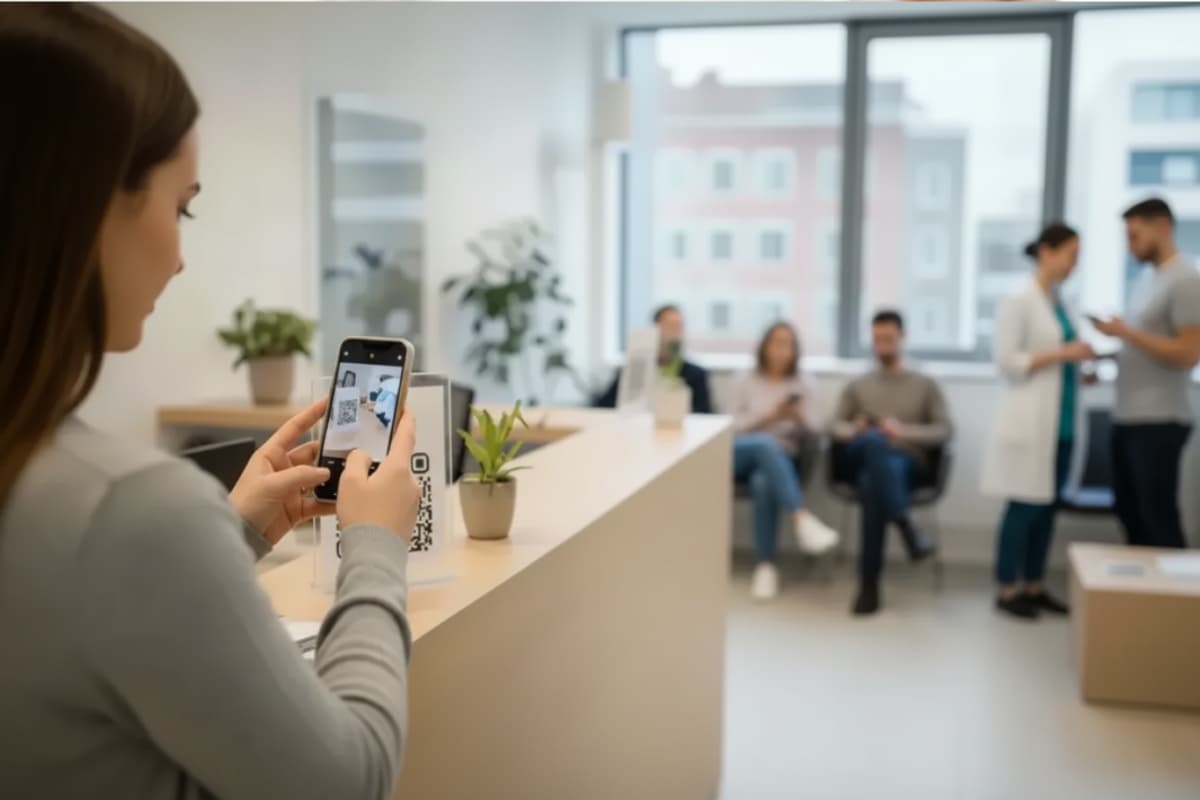1. Herausforderungen bei der Behandlung antikoagulierter Patienten
Die Situation ist Ihnen sicher vertraut: Während der Anamnese vor einer geplanten Extraktion erwähnt der Patient beiläufig die Einnahme von Blutverdünnern. In diesem Moment stellen sich unmittelbar wichtige Fragen zur Behandlungssicherheit:
- Ist eine Pausierung der Medikation erforderlich?
- Welche spezifischen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten?
- Liegt der INR-Wert im sicheren Bereich für den geplanten Eingriff?
Über 1 Million Menschen in Deutschland nehmen blutverdünnende Medikamente ein. Die bekanntesten Vertreter: ASS und Marcumar. Aber dann sind da noch die neuen, direkten oralen Antikoagulantien, kurz: DOAK. Seit deren Erfindung Anfang der 2000er Jahre hat sich die Verschreibungsrate der Antikoagulantien mehr als verdoppelt. Warum? Die Einnahme ist für die Patienten deutlich leichter. Plus, es muss kein INR mehr gemessen werden.
Die Herausforderung bei der Behandlung dieser Patienten liegt nicht nur in der Blutungsgefahr während des Eingriffs, sondern auch im Auftreten von Nachblutungen. Besonders dann, wenn sie außerhalb der Praxis-Öffnungszeiten stattfinden. Doch mit strukturiertem Vorgehen und guter Patientenaufklärung lassen sich diese Risiken minimieren.
2. Die wichtigsten Antithrombotika und ihre Indikationen
Vitamin-K-Antagonisten:
- Marcumar®, Falithrom® (Phenprocoumon)
- Coumadin® (Warfarin) - in Deutschland selten
Direkte orale Antikoagulanzien (DOAK):
- Pradaxa® (Dabigatran) – Thrombininhibitor
- Xarelto® (Rivaroxaban) – Faktor-Xa-Inhibitor
- Eliquis® (Apixaban) – Faktor-Xa-Inhibitor
- Lixiana® (Edoxaban) – Faktor-Xa-Inhibitor
Thrombozytenaggregationshemmer:
- ASS® (Acetylsalicylsäure)
- Plavix® (Clopidogrel)
- Brilique® (Ticagrelor)
- Efient® (Prasugrel)
Parenterale Antikoagulanzien:
- Clexane® (Enoxaparin)
- Fragmin® (Dalteparin)
- Heparin (unfraktioniert)
Die Wahl des richtigen Blutverdünners hängt von der Grunderkrankung des Patienten ab. Während die klassischen Medikamente wie Marcumar® regelmäßige INR-Kontrollen brauchen, kommen die neueren DOAK ohne diese Kontrollen aus. Das macht die Therapie deutlich einfacher. Besonders häufig werden Gerinnungshemmer und Antikoagulanzien bei folgenden Erkrankungen eingesetzt:
Häufigste Indikationen für Antithrombotika:
- Tiefe Venenthrombose (TVT)
- Vorhofflimmern (VHF)
- Lungenembolie (LE)
- Zustand nach Operation zur Thromboseprophylaxe (z.B. Hüft- oder Knie-TEP)
- Zustand nach Herzinfarkt oder Schlaganfall (Sekundärprophylaxe)
- Mechanische Herzklappen
- Koronare Herzkrankheit (KHK)
- Periphere arterielle Verschlusskrankheit (pAVK)
Sowohl die Indikation als auch das entsprechende Medikament bestimmen über das Absetzen oder Fortführen der Therapie. Bei Hochrisikopatienten (z.B. mit mechanischen Herzklappen) kann ein Absetzen lebensbedrohliche Folgen haben.
3. INR-Bereiche und ihre Bedeutung

Der INR-Wert (International Normalized Ratio) ist ein standardisierter Laborwert zur Überwachung der Therapie mit Vitamin-K-Antagonisten. Er gibt Auskunft über die Gerinnungsfähigkeit des Blutes. Bei gesunden Menschen ohne Antikoagulation liegt der INR-Wert bei etwa 1,0. Je höher der Wert, desto stärker ist die Blutgerinnung gehemmt. Der “Therapeutische Bereich” (Tab. 1) bezeichnet den jeweiligen Zielwert für unterschiedliche Indikationen. Ambulante zahnärztlich-chirurgische Eingriffe sollten nur bis zu einem INR von 3,5 durchgeführt werden.
4. Fünf Regeln, die Ihnen Sicherheit geben
- Immer Rücksprache mit dem Hausarzt oder Kardiologen halten, besonders bei komplexer Medikation oder zusätzlichen Risiken.
- Nur solche Eingriffe durchführen, deren Komplikationsmanagement Sie beherrschen. Wenn unsicher: Überweisung.
- Strategie zur Wundversorgung vor dem Eingriff planen: Nahtmaterial, Hämostyptika, Tranexamsäure bereitlegen.
- Patienten erst entlassen, wenn die Lokalanästhesie vollständig abgeklungen ist. (Achtung: Nachblutungsrisiko!)
- Keine risikobehafteten Eingriffe an Freitagen, um Komplikationen am Wochenende zu vermeiden.
Dokumentieren Sie immer sorgfältig die Medikamentenanamnese und den Entscheidungsprozess bezüglich des Beibehaltens oder Pausierens der Antikoagulation. Eine gute Dokumentation ist nicht nur rechtlich wichtig, sondern hilft auch bei der Nachverfolgung und Behandlungsplanung.
5. Was geht in der Praxis – und was besser nicht?
Bei "einfachen zahnärztlich-chirurgischen Eingriffen im komprimierbaren Bereich" dürfen laut der Leitlinie von 2017 die folgenden Medikamente (in Monotherapie!) weitergegeben werden:

Ambulant durchführbare Eingriffe in der Praxis:
- Einfache Extraktionen (wenige Zähne)
- Parodontalbehandlungen
- Einfache Implantationen
- Kleinere Osteotomien
Besser in einer Fachklinik:
- Umfangreichere Zahnsanierungen
- Aufwändigere Osteotomien
- Weisheitszahnentfernungen
- Umfangreiche implantologische Maßnahmen inklusive KnochenaugmentationenKnochenaufbauten
6. Notfallmanagement: Vorbereitung und Checkliste
Das sollten Sie bereithalten:
- Nahtmaterial
- Elektrokauter (wenn vorhanden)
- Hämostyptika (Kollagenkegel, Vlies, Schwämme)
- Tranexamsäure 5 % (lokale Tamponade)
- Desmopressin Nasenspray bei vWF oder FVIII-Mangel
- Verbandsplatte (vorher angefertigt)
- Alginat und Abdrucklöffel (Für den Fall, dass keine Verbandsplatte hergestellt wurde → im Patientenmund abbinden lassen)
Für die Nachsorge sollten Sie dem Patienten klare schriftliche Anweisungen mitgeben, wie er sich bei Nachblutungen verhalten soll. Dazu gehören Notfallnummern und konkrete Handlungsanweisungen. Eine Nachkontrolle am Folgetag ist bei Risikopatienten empfehlenswert.
Bei Nachblutungen:
- Kompression (mind. 20 Min.)
- Tranexamsäure getränkter Tupfer oder Mundspülung
- Erneute Nahtlegung falls nötig
- Überweisung an Fachklinik bei anhaltender Blutung
7. Red Flags: Wann besser nicht ambulant behandelt werden sollte
„Red Flags“ bezeichnen in diesem Fall klinische Warnhinweise, bei denen ein erhöhtes Risiko für Komplikationen besteht – insbesondere solche, die eine ambulante Behandlung fraglich oder sogar kontraindiziert machen.

Beachten Sie, dass bei Patienten mit mehreren Risikofaktoren (hohes Alter, Polymedikation, Leber- oder Nierenerkrankungen) das Blutungsrisiko zusätzlich erhöht sein kann, auch wenn die einzelnen Parameter im akzeptablen Bereich liegen.
8. Fazit und FAQ: Häufige Fragen und sicheres Vorgehen
Fazit: Kühlen Kopf bewahren – auch bei Antithrombotika
Antithrombotika-Patienten gehören zum Alltag. Mit diesen Regeln behalten Sie die Kontrolle und vermeiden unnötige Risiken:
- Rücksprache mit dem Arzt
- Gute Planung und Nachsorge
- Keine Alleingänge bei problematischen Konstellationen
Die Behandlung von Patienten unter Antikoagulation erfordert ein strukturiertes Vorgehen, aber keine übertriebene Angst. Mit guter Vorbereitung, sorgfältiger Blutstillung und adäquater Nachsorge können die meisten zahnärztlichen Eingriffe sicher durchgeführt werden. Entscheidend ist die individuelle Risikobewertung: Das Blutungsrisiko muss immer gegen das thromboembolische Risiko abgewogen werden (durch den verschreibenden Facharzt).
Muss ich DOAK pausieren?
Nein, bei einfachen Eingriffen reicht eine gute zeitliche Abstimmung.
Wie hoch muss der INR bei Marcumar® sein?
Bei entsprechender Indikation im therapeutischen Bereich von 2,0–3,5 (Rücksprache Hausarzt!)
Darf ich ASS einfach absetzen?
Nein, ASS 100 wird nicht pausiert - das Risiko für Herzinfarkt/Schlaganfall überwiegt.
Wie lange vor einer Implantation sollte DOAK pausiert werden?
Die Entscheidung muss individuell mit dem behandelnden Arzt getroffen werden. In der Regel 24 Stunden vorher, je nach Präparat.
Was tun bei Patienten mit dualer Plättchenhemmung/Antikoagulation?
Diese Patienten haben ein besonders hohes Blutungsrisiko. Elektive Eingriffe sollten verschoben werden, bis nur noch eine Monotherapie notwendig ist. Bei Notfällen ist eine Kliniküberweisung angezeigt.
Quellen:
S3-Leitlinie “Zahnärztliche Chirurgie unter oraler Antikoagulation / Thrombozytenaggregationshemmung”, 2017. https://register.awmf.org/de/leitlinien/detail/083-018