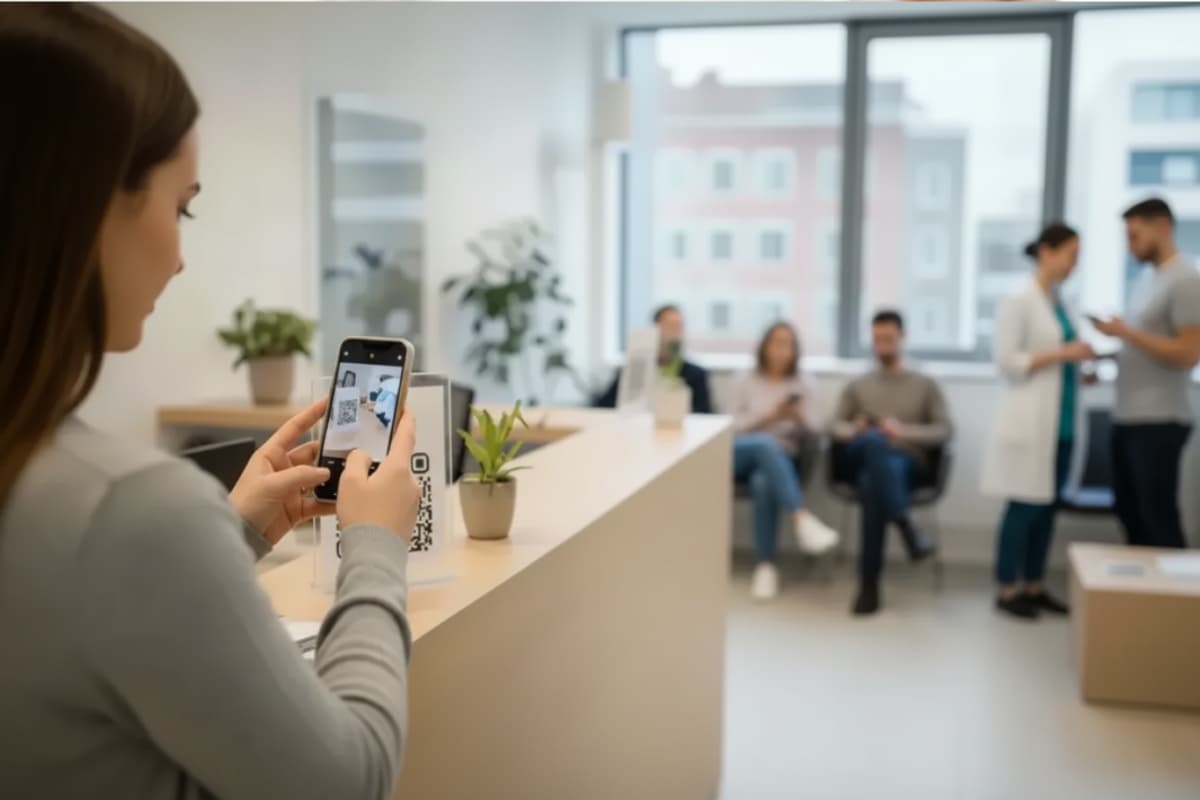Wie lässt sich die Patientenkommunikation mit digitalen Tools vereinfachen?
Digitale Tools vereinfachen die Patientenkommunikation, indem sie Informationen zentralisieren, Prozesse automatisieren und Fehler vermeiden. Wenn wiederkehrende Abläufe digitalisiert sind, profitieren alle Beteiligten: Die Praxis arbeitet effizienter, Patienten fühlen sich besser informiert – und das persönliche Gespräch gewinnt wieder Raum für das Wesentliche. Lernen Sie sechs besonders wirksame Hebel für eine einfachere Patientenkommunikation kennen.
1. Digitale Anamnese: weniger Papier, mehr Präzision
Patienten füllen ihre Anamnesebögen vor dem Termin bequem online aus – zu Hause oder auf dem Smartphone. So liegen alle relevanten Informationen bereits vor, wenn die Behandlung beginnt. Die digitale Anamnese mit Nelly spart Zeit am Empfang, reduziert Nachfragen und verringert das Risiko von Übertragungsfehlern. Gleichzeitig kann das medizinische Fachpersonal gezielter auf Beschwerden oder Vorerkrankungen eingehen, weil alle Daten vollständig und strukturiert vorliegen.
2. Digitale Signatur: schneller und rechtssicher unterschreiben
Einverständniserklärungen, Aufklärungsbögen oder Datenschutzformulare können mit Nelly ganz einfach digital unterschrieben werden. Das erleichtert die digitale Dokumentenübertragung, spart Druckkosten und Papier und erfüllt alle Anforderungen an Datenschutz und Rechtssicherheit.
3. Patientenportal: zentrale Schnittstelle für Austausch und Service
Das moderne Patientenportal von Nelly bündelt Kommunikation, Dokumente und Rechnungen an einem Ort. Patienten können auf all ihre Dokumente jederzeit zugreifen und auch Rechnungen bequem am eigenen Smartphone bezahlen, z.B. über Apple Pay.
Auch das Praxisteam profitiert: Rückrufe und Nachfragen werden weniger, Abläufe transparenter und die Erreichbarkeit verbessert sich deutlich.
4. Telemedizin: Digitale Sprechstunde
Telemedizin mit Plattformen wie TeleClinic ermöglicht ärztliche Betreuung unabhängig von Ort und Zeit – per Video, Telefon oder digitalem Austausch von Befunden. Sie macht Praxisabläufe effizienter, reduziert Wartezeiten und entlastet das gesamte Team. Routine- oder Nachsorgetermine können bequem online stattfinden, während komplexere Fälle gezielt in der Praxis behandelt werden.
Dadurch wird das Patientenaufkommen vor Ort besser gesteuert: Das Wartezimmer bleibt entspannter, Abläufe strukturierter und das medizinische Personal kann sich mehr Zeit für die Patientinnen und Patienten nehmen, die tatsächlich vor Ort sind. Auch für chronisch Erkrankte oder immobile Personen bietet Telemedizin große Vorteile – sie bleiben in engem Kontakt mit ihrem Arzt, ohne weite Wege oder lange Wartezeiten in Kauf nehmen zu müssen.
5. Fernpatientenüberwachung: Remote Patient Controling (RPM)
Beim Remote Patient Monitoring werden Gesundheitsdaten wie Herzfrequenz, Blutdruck oder Blutzucker kontinuierlich erfasst – sowohl mit dedizierten medizinischen Geräten als auch mit einfachen Smartwatches oder Fitness-Gadgets. So erhält der Arzt verlässliche Werte aus dem Alltag des Patienten, nicht nur Momentaufnahmen während eines Praxisbesuchs.
Gerade bei chronischen Erkrankungen oder Herz-Kreislauf-Problemen lassen sich Veränderungen frühzeitig erkennen und Behandlungen gezielt anpassen. Viele Symptome, die in der Praxis oft nicht mehr messbar sind, werden durch RPM sichtbar und nachvollziehbar.
Für die Praxis bedeutet das: bessere Entscheidungsgrundlagen, weniger Notfälle und eine engere Patientenbindung. Gleichzeitig fühlen sich Patienten sicherer, weil sie wissen, dass ihre Werte regelmäßig überprüft werden – ohne ständig persönlich vorbeikommen zu müssen.

Wie funktioniert DSGVO-konforme Patientenkommunikation?
Die Patientenkummunikation unterliegt besonders hohen Datenschutzanforderungen. Gesundheitsdaten zählen nach der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) zu den „besonders sensiblen personenbezogenen Daten“ – sie dürfen daher nur mit ausdrücklicher Rechtsgrundlage und unter strengen Sicherheitsvorkehrungen verarbeitet werden.
Damit der Austausch im Praxisalltag sicher und rechtskonform bleibt, sollten folgende Grundprinzipien beachtet werden:
- Einwilligung einholen: Patienten müssen vorab zustimmen, dass ihre Daten elektronisch verarbeitet oder übermittelt werden dürfen. Dieser Schritt kann ganz einfach in die digitale Anamnese mit Nelly eingebunden werden.
- Transparenz schaffen: Offenlegen, welche Daten wofür genutzt und wie lange gespeichert werden.
- Zweckbindung beachten: Daten nur für medizinisch notwendige oder organisatorische Zwecke verwenden.
- Datenminimierung umsetzen: Nur so viele Informationen erfassen, wie für die Behandlung erforderlich sind.
- Sichere Kommunikationskanäle nutzen: Verschlüsselte E-Mails, zertifizierte Patientenportale oder DSGVO-konforme Messenger einsetzen. Nur Tools verwenden, deren Serverstandort in der EU liegt und die einen Auftragsverarbeitungsvertrag anbieten. Lösungen von Nelly erfüllen diese Punkte.
- Zugriffsschutz gewährleisten: Geräte mit Passwort, Zwei-Faktor-Authentifizierung und Rollenrechten absichern.
- Team schulen: Regelmäßige Datenschutz-Schulungen für alle Mitarbeitenden durchführen.
- Verarbeitung dokumentieren: Datenzugriffe, Änderungen und Löschungen nachvollziehbar protokollieren. Dieser Punkt wird von digitalen Tools wie Nelly in der Regel automatisch abgewickelt.
- Auskunftsrecht beachten: Patienten haben jederzeit Anspruch auf Einsicht in ihre gespeicherten Daten. Hier hilft es, wenn der Großteil der Dokumente digital vorliegt und nicht in Papierakten – ein weiteres Argument für das Nelly Praxisportal.
Welche Kommunikationsmodelle lassen sich auf die Patientenkommunikation übertragen?
Digitale Tools können viele Abläufe vereinfachen, doch was hilft bei der zwischenmenschlichen Kommunikation im Behandlungszimmer? Hier bieten Kommunikationsmodelle wertvolle Orientierung. Sie machen sichtbar, was zwischen den Zeilen geschieht, wie Missverständnisse entstehen und wie ein respektvoller Dialog gelingt. Folgende Modelle lassen sich besonders gut auf den Praxisalltag übertragen.
Sender-Empfänger-Modell (Shannon & Weaver)
Kommunikation ist ein Informationsaustausch, der durch Störungen leicht beeinträchtigt werden kann. Dieses Modell fördert Bewusstsein für klare Sprache, aktives Nachfragen und Rückversicherung („Haben Sie das so gemeint?“).
Vier-Ohren-Modell (Schulz von Thun)
Jede Botschaft enthält vier Ebenen: Sache, Selbstoffenbarung, Beziehung und Appell. Dieses Modell hilft, emotionale Untertöne zu erkennen und Missverständnisse in Arzt-Patienten-Gesprächen zu vermeiden.
Watzlawicks 5 Axiome
„Man kann nicht nicht kommunizieren“ – Haltung, Tonfall und Körpersprache wirken immer mit. Dieses Modell sensibilisiert für nonverbale Signale und bezieht Aspekte wie Beziehungen, Kommunikationsmedium und Wechselwirkungen mit ein.
LIMO-Prinzip
LIMO-Prinzip für Lob, Interesse, Mangel und Offenheit. Es hilft, Beschwerden wertschätzend und lösungsorientiert zu begegnen: Zuerst Dank für den Hinweis, dann echtes Interesse, den Mangel sachlich benennen und eine gemeinsame Lösung anbieten.
Checkliste für eine respektvolle Patientenkommunikation
Um sämtliche Kommunikationsmodelle wirklich zu verinnerlichen, braucht es viel Erfahrung und praktische Übung. Sabine Monka-Lammering, Lehrerin für Zahnmedizinische Fachangestellte, hat für uns die wichtigsten Punkte der zwischenmenschlichen Patientenkommunikation zusammengefasst: Tipps zur Kommunikation mit Patienten. Hier finden Sie die Kernaussagen als praktische Checkliste:
.jpg)
1. Positive Atmosphäre von Anfang an
- Freundlicher Empfang mit direkter Ansprache und Blickkontakt.
- Alle Mitarbeitenden tragen Namensschilder.
- Offenheit und Ruhe signalisieren: kein Augenrollen, keine negativen Gesten.
- Neupatienten aktiv Orientierung geben (Wartebereich, Abläufe, Ansprechpartner).
2. Verständlich sprechen und aktiv zuhören
- Fachbegriffe vermeiden oder erklären, einfache Sprache nutzen.
- Komplexe Informationen in Etappen vermitteln („Salami-Technik“) und Verständnis prüfen.
- Nonverbale Signale (Blick, Haltung, Pausen) bewusst wahrnehmen.
3. Empathisch und authentisch auftreten
- Sich in den Patienten hineinversetzen. („Ich verstehe, dass das belastend ist.“)
- Wertschätzung zeigen und Stress erkennen. („Ich nehme mir gleich einen Moment Zeit für Sie.“)
- Empathie auch durch Körperhaltung, Mimik und Stimme ausdrücken.
5. Klar, ehrlich und lösungsorientiert kommunizieren
- Transparente Informationen zu Terminen, Wartezeiten und Behandlungsschritten geben.
- Themen direkt, aber sensibel ansprechen
- Positive Formulierungen wählen (statt „Das ist nicht mein Zuständigkeitsbereich“ besser „Ich leite Ihre Frage direkt an den Kollegen weiter.)
4. Schwierige Situationen mit Feingefühl meistern
- Heikle Themen besonders gut vorbereiten: Anamnese, Diagnosen und bisherigen Verlauf kennen.
- Gefühle des Patienten zulassen und empathisch reagieren; Rückzug respektieren.
- Schwierige Patienten nicht als „nervig“ abstempeln, sondern Verständnis für Unzufriedenheit zeigen („Danke, dass Sie das ansprechen“).
- Bei Drohungen oder Aggression Grenzen setzen.