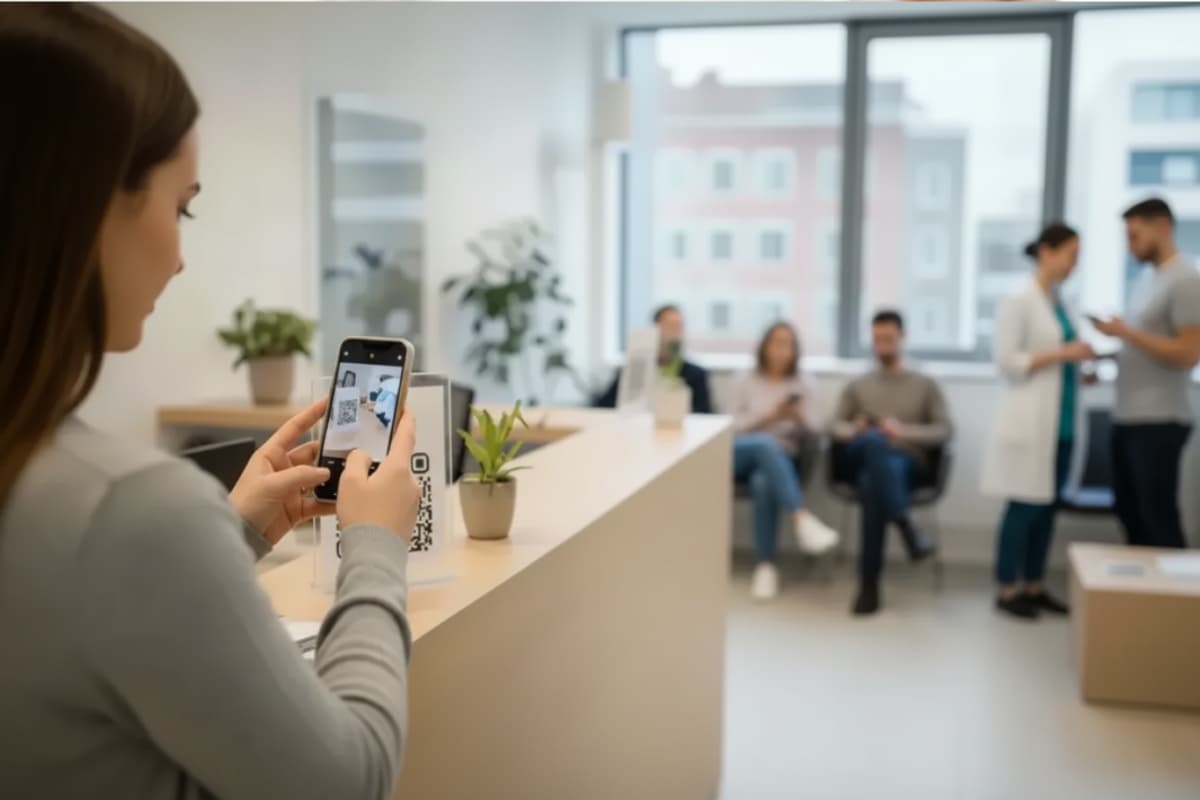Was ist Telemedizin?
Telemedizin bedeutet, dass medizinische Leistungen auch ohne direkten Kontakt zwischen Arzt und Patient stattfinden können. Möglich wird das durch digitale Technologien wie Videotelefonie, Online-Sprechstunden, Gesundheits-Apps oder elektronische Patientenakten.
Dabei geht es nicht nur um einfache Gespräche per Video. Auch die Überwachung chronischer Krankheiten, das Teilen medizinischer Daten oder die Zusammenarbeit mehrerer Fachärzte kann digital erfolgen. Selbst Krankschreibungen und Rezepte lassen sich online übermitteln.
Telemedizin soll den Zugang zur Versorgung erleichtern, Wege und Wartezeiten sparen und besonders in ländlichen Regionen oder bei eingeschränkter Mobilität eine wichtige Ergänzung zur klassischen Arztpraxis bieten.

Wer bietet Telemedizin an?
In Deutschland und darüber hinaus gibt es unterschiedliche Akteure im Bereich der Telemedizin:
1. Klassische Arztpraxen und Krankenhäuser
Über zertifizierte Videodienstanbieter können niedergelassene Ärzte und klinische Einrichtungen Telekonsultationen anbieten. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) veröffentlicht regelmäßig eine Liste zugelassener Videoplattformen. Aktuell sind mehr als 50 Dienste bis mindestens Ende 2027 zertifiziert.
2. Online-Arztpraxen (Direktanbieter)
Plattformen wie Teleclinic, Zava (vormals DrEd) und Monks – Ärzte im Netz ermöglichen Video- oder Telefonsprechstunden, Rezeptausstellung und Krankschreibungen komplett digital. Zava allein führte bereits über 1,4 Millionen Telebehandlungen in Deutschland durch.
3. Interdisziplinäre Gesundheitsplattformen
Dienste wie Nelly, Doctolib und CGM (CompuGroup Medical) bieten umfassende Tools für Terminmanagement, Videosprechstunde und digitale Aktenführung. Ziel ist es, die organisatorischen Abläufe in Praxen zu digitalisieren und die Patientenkommunikation effizienter zu gestalten.
Nelly etwa unterstützt Arztpraxen bei der digitalen Rechnungsstellung, beim Dokumentenversand, dem Forderungsmanagement sowie beim Bewertungsmarketing (inklusive nahtloser Integration in bestehende Praxisverwaltungssysteme).
4. Spezialisierte Telemedizin-Unternehmen
Anbieter wie SHL Telemedizin, Docs in Clouds, TeleCare oder telmedicon setzen auf spezielle Fachbereiche, beispielsweise kardiologisches Monitoring oder Pflege via TeleDoc-System.
5. Internationale Anbieter und Start‑ups
Zu den führenden Start‑ups in Deutschland zählen Teleclinic, Kranus Health, Monks, InnoSphere, Dermanostic, MindDoc, CardioSecur u. a. Auf europäischer Ebene sind auch Philips, MindMaze oder Onera Health aktiv.
Wie funktioniert Telemedizin in Deutschland?
Telemedizin läuft in der Praxis meist unkompliziert ab. Patienten melden sich über eine App, ein Online-Portal oder per Link an und erhalten eine digitale Beratung, Diagnose oder Rezeptausstellung.
Gleichzeitig kümmert sich die technische Plattform im Hintergrund um Datenschutz, Dokumentation und Abrechnung.
Auch für Arztpraxen ist die Einbindung heute theoretisch leicht umsetzbar. Viele Systeme bieten zertifizierte Videodienste, digitale Formulare und automatisierte Abläufe, die sich in bestehende Praxissoftware integrieren lassen.
Welche Voraussetzungen gelten für Telemedizin?
Damit eine telemedizinische Behandlung in Deutschland rechtlich zulässig ist, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein:
- Zustimmung des Patienten: Die Teilnahme an einer Videosprechstunde oder einer digitalen Behandlung muss freiwillig erfolgen. Der Patient muss darüber informiert werden, wie die Behandlung abläuft und wie mit seinen Daten umgegangen wird.
- Technische Sicherheit: Die genutzte Videoplattform muss von der KBV zertifiziert sein und den Anforderungen der DSGVO entsprechen. Dazu zählen etwa Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, Serverstandorte in der EU und eine stabile Verbindung.
- Ärztliche Sorgfaltspflicht: Auch digital gelten dieselben Qualitätsstandards wie in der Praxis. Ärztinnen und Ärzte müssen sorgfältig prüfen, ob sich ein Anliegen telemedizinisch sinnvoll behandeln lässt oder ein persönlicher Kontakt notwendig ist.
- Dokumentation und Abrechnung: Die Behandlung muss wie jede andere medizinische Leistung dokumentiert werden. Abgerechnet wird meist über die Kassenärztliche Vereinigung, je nach Versorgungsmodell auch privat oder über digitale Direktanbieter.
Welche Beispiele gibt es für Telemedizin?
Telemedizin wird in vielen Bereichen der Versorgung erfolgreich eingesetzt. Einige Beispiele:
- Videosprechstunde beim Hausarzt: Besonders beliebt bei leichten Infekten, Befundbesprechungen oder Folgerezepten. Immer mehr Hausarztpraxen bieten diesen Service inzwischen an – oft kurzfristig buchbar.
- Digitale Psychotherapie: Bei Depressionen, Ängsten oder Stressproblemen sind Online-Therapien über zertifizierte Anbieter wie MindDoc oder Selfapy eine etablierte Ergänzung zur Vor-Ort-Therapie.
- Dermatologische Fernbeurteilung: Patienten laden Fotos ihrer Hautveränderungen hoch und erhalten binnen 24 bis 48 Stunden eine fachärztliche Einschätzung (z. B. über Anbieter wie Dermanostic).
- Telemonitoring bei chronischen Erkrankungen: Patienten mit Herzinsuffizienz, Diabetes oder Bluthochdruck übermitteln regelmäßig Vitalwerte an das betreuende Praxisteam. Das kann Komplikationen frühzeitig verhindern.
- Elektronisches Rezept (E-Rezept): Seit Anfang 2024 ist es Pflicht in Deutschland. Patienten erhalten das Rezept per App oder Ausdruck und lösen es in jeder Apotheke oder online ein.
Die Möglichkeiten der Telemedizin werden in den kommenden Jahren weiter wachsen, insbesondere durch die Kombination mit künstlicher Intelligenz, digitalen Gesundheitsanwendungen (DiGA) und smarter Medizintechnik.
Welche Krankenkassen bieten Telemedizin an?
Nahezu alle großen gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland unterstützen telemedizinische Leistungen. Einige bieten eigene Plattformen an oder kooperieren mit spezialisierten Anbietern. Beispiele:
- AOK arbeitet regional mit Telemedizin-Diensten zusammen und fördert unter anderem Videosprechstunden bei Haus- und Fachärzten.
- Techniker Krankenkasse (TK) bietet über die App TK-Doc direkten Zugang zu telemedizinischer Beratung durch Ärzte.
- Barmer ermöglicht digitale Sprechstunden und unterstützt Telemonitoring bei bestimmten chronischen Erkrankungen.
- DAK-Gesundheit bietet digitale Arzttermine und Programme wie Online-Psychotherapie.
- SBK, HEK, hkk und andere Krankenkassen unterstützen telemedizinische Leistungen im Rahmen der Regelversorgung oder in Modellprojekten.
Private Krankenversicherungen (z. B. Allianz, Debeka, Ottonova) bieten ebenfalls digitale Arztkontakte an. Einige haben Telemedizin als festen Bestandteil ihrer Tarife integriert.
Welche Telemedizin-Apps gibt es?
Der Markt für Telemedizin-Apps ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Hier einige etablierte und spezialisierte Lösungen:
- TeleClinic: Führender Anbieter in Deutschland mit Online-Sprechstunde, Rezeptausstellung, Krankschreibung und Überweisungen. Für gesetzlich und privat Versicherte.
- ZAVA: Online-Arztpraxis für viele Bereiche, insbesondere Sexualgesundheit, Hautprobleme, Erkältung, Verhütung und Reisemedizin.
- Dermanostic: Dermatologische App für Hautdiagnosen per Foto. Befund und Therapieempfehlung kommen innerhalb von 24 Stunden.
- Kry: Europäischer Anbieter mit Online-Sprechstunde und umfassender Patienten-App. Aktuell in mehreren EU-Ländern aktiv.
- MindDoc: App-basierte psychologische Begleitung, insbesondere für depressive Verstimmungen, Ängste und Erschöpfung.
- Selfapy: Digitale psychologische Kurse für gesetzlich Versicherte – oft vollständig von Krankenkassen übernommen.
- HelloBetter: DiGA-gelistete App für Online-Therapieprogramme mit klinischer Begleitung.
Telemedizin in der ärztlichen Praxis
Wie funktioniert die Abrechnung von Telemedizin?
Ärzte können telemedizinische Leistungen wie Videosprechstunden, elektronische Arztbriefe oder Fernbeobachtung direkt über die Kassenärztliche Vereinigung abrechnen – entweder über die gesetzliche Krankenversicherung oder privat.
Für gesetzlich Versicherte gelten die Vorgaben des Einheitlichen Bewertungsmaßstabs (EBM). Wichtig ist, dass der genutzte Videodienst von der KBV zertifiziert ist und die Leistung korrekt dokumentiert wird.
Es gelten bestimmte Höchstgrenzen, etwa für den Anteil telemedizinischer Leistungen pro Quartal. Diese wurden aber zuletzt immer weiter gelockert.
Bei Privatpatienten erfolgt die Abrechnung in der Regel über die Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ), wobei auch hier zunehmend telemedizinische Leistungen anerkannt werden.
Welche Vorteile bringt Telemedizin für Ärzte?
Für Ärzte bietet Telemedizin nicht nur einen modernen Service für Patienten, sondern auch ganz konkrete Vorteile im Arbeitsalltag:
- Bessere Erreichbarkeit: Patienten können unkompliziert und ortsunabhängig betreut werden, auch außerhalb regulärer Sprechzeiten.
- Zeitgewinn: Routinefälle wie Befundbesprechungen oder Folgerezepte lassen sich schneller digital abwickeln.
- Mehr Planungssicherheit: Digitale Terminvergabe, automatisierte Erinnerungen und strukturierte Dokumentation reduzieren Ausfälle und Rückfragen.
- Zusätzliche Einnahmen: Auch kurze Telekontakte können abgerechnet werden – gerade bei chronischen Patienten ein finanzieller Vorteil.
- Weniger Bürokratie: In Kombination mit digitalen Tools wie Nelly können auch Dokumente, Rechnungen oder Bewertungen automatisiert abgewickelt werden.
Vor allem in ländlichen Regionen oder bei Fachärzten mit hoher Nachfrage kann Telemedizin helfen, den Versorgungsdruck zu reduzieren.
Was sind die rechtlichen Rahmenbedingungen?
Ärzte dürfen Telemedizin in Deutschland einsetzen, wenn die Behandlung medizinisch vertretbar ist, der Patient zugestimmt hat und die ärztliche Sorgfaltspflicht gewahrt bleibt. Grundlage dafür ist die Musterberufsordnung, die 2018 angepasst wurde.
Die Behandlung muss vollständig dokumentiert werden. Außerdem müssen zertifizierte Videodienste genutzt und die Datenschutzvorgaben nach DSGVO eingehalten werden. In Zweifelsfällen ist eine persönliche Untersuchung weiterhin notwendig.

Digitalisierung in der Praxis einfach umsetzen
Telemedizin zeigt, wie moderne Praxisführung heute funktioniert: Digital, effizient und patientennah.
Mit Nelly integrieren Sie genau die Bausteine, die Ihren Alltag spürbar entlasten:
- Digitale Anamnese
- Digitaler Dokumentenversand
- Digitale Abrechnung und Factoring
- Automatisierte Patientenbewertungen
- und vieles mehr
All das funktioniert ohne lange Einarbeitung, ohne Technikfrust und ohne großen Umstellungsaufwand.
Lassen Sie uns gemeinsam herausfinden, wie Ihre Praxis von digitalen Prozessen profitieren kann.
Jetzt Kontakt aufnehmen und Nelly kennenlernen.
Spezialfall: Telemedizin und medizinisches Cannabis
Der Zugang zu medizinischem Cannabis ist in den letzten Jahren deutlich digitaler geworden.
Patienten können die Therapie meist über Onlineformulare und digitale Fragebögen anstoßen – ohne dass zwingend ein persönlicher Besuch in der Praxis erforderlich ist.
In der Vergangenheit reichten in Einzelfällen sogar vollständig automatisierte Abläufe ohne Videosprechstunde aus.
Hinweis: Gerichtsurteile vom März und Juni 2025 sehen diese Praxis zunehmend kritisch. So untersagte z. B. das Landgericht München I (13. Juni 2025) die Werbung mit Cannabis-Verordnungen ohne persönlichen Arztkontakt. Auch das Oberlandesgericht Frankfurt (6. März 2025) bestätigte: Ärztliche Aufklärung muss individuell erfolgen, pauschale digitale „Erstgespräche“ sind nicht zulässig.
Befürworter sehen im digitalen Zugang weiterhin eine wichtige Entlastung für chronisch Erkrankte. Kritiker betonen die Risiken durch fehlende Begleitung.
Entscheidend bleibt: Auch online gelten ärztliche Standards, Dokumentationspflicht und Prüfung der Indikation. Die Kostenübernahme durch gesetzliche Krankenkassen setzt in der Regel eine Genehmigung voraus.
Häufige Fragen
Wer darf Telemedizin machen?
Telemedizin darf in Deutschland von approbierten Ärzten durchgeführt werden, die zur Ausübung des Berufs berechtigt sind. Die Fernbehandlung muss medizinisch vertretbar sein und erfolgt in der Regel über zertifizierte Videodienste.
Ist Telemedizin in Deutschland erlaubt?
Ja. Seit 2018 ist die ausschließliche Fernbehandlung rechtlich erlaubt – sofern sie ärztlich verantwortbar ist, der Patient einwilligt und die Behandlung dokumentiert wird. Berufsrecht, Datenschutz und Technikstandards müssen eingehalten werden.
Für welche Patientengruppe ist Telemedizin besonders sinnvoll?
Besonders profitieren Patienten mit chronischen Erkrankungen, eingeschränkter Mobilität oder langen Anfahrtswegen. Auch bei leichten Beschwerden, Kontrollterminen oder psychologischer Beratung ist Telemedizin eine praktische Lösung.